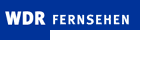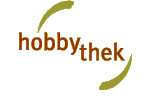|
| | hobbytipp 339  Aloe vera und Co - Lebenselixiere aus dem Mittelalter  | | Die Medizin des Mittelalters |  | |
"Ich schwöre bei Apollon dem Arzt und bei Asklepios, Hygieia und Panakeia, alle Maßnahmen nach Kräften und gemäß meinem Urteil zum Nutzen der Kranken einzusetzen."
So etwa schwören seit der Antike alle Mediziner zum Abschluss ihrer Studien. Überliefert wurde uns der Eid des Hippokrates durch die Übersetzungen mittelalterlicher Klostermediziner. Diesen Forschern haben wir es zu verdanken, dass Jahrtausende altes Wissen bis heute erhalten geblieben ist. Zu einer Zeit, als es noch keinen Buchdruck gab, war jedes Schriftstück ein Unikat. Mit dem Verlust eines Dokumentes konnten wissenschaftliche Entdeckungen auf ewig verloren gehen. Die einzige Sicherheit bestand darin, möglichst viele Kopien zu erstellen. Diese Aufgabe übernahmen im Mittelalter die namenlosen sogenannten Kopisten, die in den zahlreichen Klöstern lebten. |
   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | In den Klöstern lebten
neben zahlreichen
Kopisten auch heil-
kundige Brüder
|  |
Dank der akribischen Arbeit der Mönche sind einige antike Quellen bis heute überliefert. Zwei davon wirkten auf die Medizin des Abendlandes besonders nachhaltig. Plinius der Ältere galt schon in der Antike als ein Allroundgenie, denn neben seiner Tätigkeit als Feldherr, Flottenchef und Politiker war seine echte Leidenschaft die Naturwissenschaft. In einem 37-bändigen Monumentalwerk fasste Plinius das gesamte medizinische Wissen der griechischen und römischen Antike zusammen - eine Art frühe medizinische Enzyklopädie.
   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Plinius' Monumentalwerk
war eine Art frühe medi-
zinische Enzyklopädie
|  |
Der Arzt Claudius Galenos - meist einfach "Galen" genannt - wurde in der Nachwelt bekannter. Er lebte im 2. Jahrhundert nach Christus im kleinasiatischen Pergamon und prägte wie kein anderer die abendländische Medizin. Denn Galen war der erste, der Regeln für die Zubereitung von Arzneimitteln aufstellte. Deshalb bezeichnet man dieses Regelwerk in der Pharmakologie auch heute noch als Galenik.
 | | Vier-Säfte- und Signaturenlehre |  | |
Zudem entwickelte Galen eine frühe Krankheitslehre, die als Vier-Säfte-Lehre populär wurde und die Medizin über Jahrhunderte hinweg bestimmte. Darin ging er davon aus, dass die vier Säfte Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle sich im menschlichen Körper im Gleichgewicht befinden. Verschiebt sich das Gleichgewicht, so erkranke der Mensch.
Während man im Mittelalter mit Hilfe der Vier-Säfte-Lehre nach Erklärungen für Krankheiten suchte, bildete die Signaturenlehre die Grundlage für die Behandlung der Krankheiten. Sie sollte dem behandelnden Arzt helfen, die richtige Heilpflanze zu finden.
Man stellte sich damals vor, dass alle Pflanzen zum Wohle des Menschen erschaffen waren. Damit der Mensch aber erkennen kann, welches Kraut gegen welche Krankheit hilft, sind die Pflanzen mit bestimmten Merkmalen - den sogenannten Signaturen - ausgestattet. Diese sollten Hinweise auf das Anwendungsgebiet der Heilpflanzen geben. Die gefleckten Blätter des Lungenkrauts z. B. haben Ähnlichkeit mit dem Lungengewebe und deshalb glaubten die Heilkundigen des Mittelalters, dass es gegen Erkrankungen der Bronchien und Lungen hilft. Bis heute spiegelt sich dieser Glaube im deutschen Namen wider. |
   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Äußerlich ähnelt die Wal-
nuss dem menschlichen
Gehirn. Die Menschen im
Mittelalter glaubten des-
halb, dass diese Frucht
Erkrankungen des Ge-
hirnes heilen könnte.
|  |
So abwegig diese Theorie für die moderne Wissenschaft ist - die Signaturenlehre ist noch immer nicht ganz verschwunden und kann uns noch heute im Alltag begegnen. Das belegen z.B. Brennnessel-Shampoos, wie sie zuhauf in Drogerien zu kaufen sind. Genau genommen ist es der mittelalterlichen Signaturenlehre zu verdanken, dass es diese Shampoos heute noch gibt. Denn damals dachte man, dass die feinen Härchen der Brennnessel ein Zeichen für die spezielle Heilwirkung der Pflanze auf das menschliche Haar seien. Möglicherweise regen die enthaltenen Säuren in der Brennnessel tatsächlich die Durchblutung der Kopfhaut an. Das könnte Haarausfall verzögern, vermuten einige Wissenschaftler heute.
   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Die feinen Härchen der
Brennnessel erinnern an
menschliches Haar.
|  |
Viele Ansichten der mittelalterlichen Medizin sind veraltet und mit unserem heutigen naturwissenschaftlichen Wissen kaum vereinbar. Doch auch wenn wir heute über solche Vorstellungen lächeln: Wir dürfen nicht vergessen, dass sie den Menschen des Mittelalters durchaus geholfen haben. Die Signaturenlehre und auch die Vier-Säfte-Lehre brachten System ins Chaos. Die Pflanzenvielfalt war auf einmal überschaubar und es wurde möglich, aus der Vielzahl die Wildpflanzen herauszufinden, die tatsächlich gegen bestimmte Krankheiten wirken.
| | |