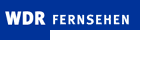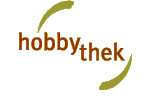|
| | hobbytipp 339  Aloe vera und Co - Lebenselixiere aus dem Mittelalter   Der Klostergarten für den eigenen Balkon   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | In mittelalterlichen Klös-
tern wurden Dutzende
verschiedenartiger Heil-
pflanzen gezüchtet. |  |
Geprägt durch den christlichen Grundgedanken der Nächstenliebe übernahmen das ganze Mittelalter hindurch Klöster die Funktion der örtlichen Krankenstation. Da die Grundlage der damaligen Medizin die Pflanzenheilkunde war, kam den Klostergärten eine ganz besondere Bedeutung zu. Früh schon legte man neben dem Nutzgarten mit zahlreichen Gemüsen auch spezielle Kräutergärten an. Der Einfachheit halber wurden Pflanzen mit einer ähnlichen Wirkung in gemeinsame Beete gesetzt. So war die Ernte für den unkundigen Gehilfen einfacher. Der brauchte nur in das entsprechende Beet zu greifen, um die richtige Pflanze - etwa gegen Fieber - herauszuholen.
Auch heute noch kann man sich einen kleinen Klostergarten auf dem Balkon oder im Garten anlegen. Dafür benötigt man nicht Dutzende von verschiedenartigen Pflanzen wie man sie in mittelalterlichen Klostergärten vorfand. Auch eine kleine Handvoll tut gute Dienste. Vier, die man einfach bekommt und die nicht viel Pflege brauchen, haben wir dafür ausgewählt.
  Thymian - Kraftprotz gegen Bakterien und Viren   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Beim Thymian haben
Bakterien kaum eine
Chance. |  |
Schon die griechischen Quellen der Klostermediziner singen ein Loblied auf ihn. Damals war man der Ansicht, dass der Thymian bei so verschiedenen Krankheiten wie Leber- und Milzproblemen, bei Asthma aber auch gegen Würmer hilft. Vieles von dem, was ihm nachgesagt wurde, konnten Wissenschaftler nicht bestätigen. Eines jedoch ist heute belegt: Thymian hat die stärkste antiseptische Wirkung aller heimischen Pflanzen. Er ist reich an verschiedenen ätherischen Ölen, Gerbstoffen und so genannten Flavonoiden. Hauptwirkstoff jedoch ist das Thymol, ein pflanzliches Phenol. Es ist wirksam gegen Bakterien und Viren und fördert die Durchblutung der Haut. Deshalb hilft Thymian sehr gut bei Entzündungen im Hals- und Rachenraum, aber auch bei Erkrankungen der Atemwege.
Die Pflanze ist ausdauernd und wird ca. 30 Zentimeter hoch. Allerdings verholzt sie sehr leicht und sollte deshalb alle drei Jahre erneuert werden. Die Pflanzung kann im Herbst oder Frühjahr vorgenommen werden. Als Flachwurzler kann Thymian auch gut in Blumentöpfen gedeihen und eignet sich so ausgezeichnet für den Balkon.
 | | Thymiantee |  | |
Ein Thymiantee ist zugegebenermaßen ein wenig gewöhnungsbedürftig, kann aber bei Erkältungskrankheiten kleine Wunder bewirken.
|
 | | Rezept |  |  |  | 2 TL Thymiankraut
|  |  |  | eine Tasse Wasser |
 | |
Wie bei vielen Kräutertees zunächst das Wasser kochen, vom Herd nehmen, die Kräuter hinzufügen und zugedeckt etwa fünf Minuten ziehen lassen. Mehrmals täglich eine Tasse möglichst heiß trinken.
Aber Thymian lässt sich nicht nur als Tee verwenden. In Saudi-Arabien sind Thymianbrote als leichter und gesunder Snack auf dem Schulhof beliebt.
|
 | | Thymianbrot - der gesunde Pausensnack |  | |
|
 | | Rezept |  |  |  | Brotfladen oder auch beliebige Brotsorte
|  |  |  | Getrockneter und fein gemahlener Thymian
|  |  |  | Olivenöl
|  |  |  | Sesam |
   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Gesunder Pausensnack
aus Saudi Arabien -
Thymianbrot
|  |
Das Brot mit Olivenöl beträufeln, Thymian und Sesam darüber streuen und nach Geschmack salzen. In einigen arabischen Lebensmittelgeschäften sind auch fertige Gewürzmischungen unter dem Namen "s�rtar" erhältlich, die nur noch unter das Olivenöl gerührt werden müssen.
  Salbei - die "heilende" Pflanze   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Salbei hat vorzügliche
antiseptische Eigen-
schaften. |  |
Ein wohlschmeckender Tee lässt sich aus Salbei zubereiten. Aber über den Geschmack hinaus entwickelt Salbei auch eine ganz besonders intensive Heilwirkung. Das kann man auch schon am Namen erkennen. Der lateinische Namen"Salvia" leitet sich von "salvare" ab, was so viel bedeutet wie "heilen" oder "bewahren". Das zeigt, wie universell Salbei in der frühen Heilkunde eingesetzt wurde. Er fehlte in keinem Klostergarten. Der mehrjährige Strauch wird bis zu 50 Zentimeter hoch. Am besten gedeiht er in sonniger Lage auf magerem, steinigen Boden. Will man neue Salbeipflanzen setzen, so ist der Herbst und das Frühjahr die beste Zeit dafür. Da der alte Salbeistock leicht verholzt, sollte man alle 5 Jahre neue Ableger oder frische Pflänzchen setzen.
Spülungen mit Salbeitee haben sich bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum bewährt - mehrmals täglich gurgeln.
 | | Rezept |  |  |  | 2 - 3 Salbeiblätter
|  |  |  | eine Tasse Wasser |
 | |
Frische oder getrocknete Salbeiblätter in einen Topf mit vorher gekochtem Wasser geben. Etwa fünf Minuten zugedeckt ziehen lassen. Mit der noch lauwarmen Flüssigkeit mehrmals täglich spülen. Selbstverständlich kann aus den Salbeiblättern auf gleiche Art und Weise ein Tee hergestellt werden. Auch dieser sollte möglichst warm getrunken werden. |
  Spitzwegerich - "gekautes" Heilmittel  Eigentlich wächst Spitzwegerich wild auf zahlreichen Wiesen. Inzwischen gibt es bei uns aber auch Samen zu kaufen, um ihn gezielt im Garten zu ziehen. Die mittelalterlichen Klösterbücher nennen ihn "kühlend und trocknend". Der Spitzwegerich ist eine Art Erste Hilfe bei Schürfwunden und Insektenstichen. Seine Blätter werden einfach zerrieben und auf die Wunde aufgelegt.
Eine auf den ersten Blick abenteuerlich anmutende Anwendung hat sich aus dem Mittelalter bis in unsere heutige Volksheilkunde herüber gerettet: Wenn man die Spitzwegerichblätter vorher im Mund zerkaut, wirken sie noch besser - und das ist biochemisch sogar nachzuvollziehen.
  Die Heilwirkung des Spitzwegerichs wird noch gesteigert, wenn man ihn vor dem Auftragen auf Schürfwunden zerkaut:
In den Blättern sind verschiedene Zuckerstoffe enthalten, darunter auch das sogenannte Aucubin. Dieser Stoff wirkt schon an sich antibakteriell, aber diese Wirkung kann durch den menschlichen Speichel erhöht werden. Der enthält Enzyme, darunter die Glykosidasen, die die Zuckergruppe des Aucubins abspalten können. Damit verwandeln sie das Aucubin in Aucubigen. Dieses Aucubigen hat eben eine noch bessere entzündungshemmende Wirkung als der ursprüngliche Stoff der Pflanze.
  Ringelblume - mehr als nur Gartenschönheit   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Die Blüten der Ringel-
blume lassen sich
zu hautfreundlichen Kos-
metika verarbeiten. |  |
Geradezu Lobeshymnen sang Hildegard von Bingen auf die Ringelblume. Damit war sie die Erste, denn die Ringelblume spielte in der antiken Medizin kaum eine Rolle. Die Äbtissin beschreibt die Blätter, Blüten und den Saft der Calendula - wie die Ringelblume offiziell heißt - als entzündungshemmend.
Wen wundert es da, dass wir auch heute noch in Apotheken und Drogerien eine Vielzahl von Salben und Cremes, aber auch Shampoos, Seifen, Badeöle und sogar Sonnenschutzmittel finden, die Calendula enthalten. Fette und ätherische Öle, Carotinoide, Flavonoide, Saponine und Polysacharide sind in ihr enthalten, ein Vielstoffgemisch, das eben mehr ist als nur die Summe der Einzelteile. Es spricht für die traditionelle Heilkunde, dass die Wirksamkeit der Heilpflanze durch jahrhundertelange Anwendung nachgewiesen wurde, die moderne Medizin aber bis heute die Wirkmechanismen nicht genau erklären kann. Sie können natürlich auf die gekauften Produkte zurückgreifen. Dann wissen Sie aber nicht, welche Art von Ringelblume darin ist oder ob sie nur aus einem Extrakt hergestellt wurden. Deshalb lohnt sich in jedem Fall der Versuch, selber Calendula-Produkte herzustellen.
 | | Calendula-Salbe |  | |
Für die Herstellung einer Salbe werden die Heilkräuter zusammen mit Öl oder Fett sanft erhitzt, um die fettlöslichen Inhaltsstoffe zu extrahieren. Hierfür eignet sich weiche Vaseline oder aber auch Olivenöl. Alternativ kann man auch wasserfreies Eucerin verwenden - ein Gemisch aus Fetten und Wachsen der Schafwolle sowie Vaseline. "Eucerinum anhydricum", so heißt es lateinisch, ist in jeder Apotheke erhältlich.
|
 | | Rezept |  |  |  | 30g getrocknete oder frische Calendula-Blüten
|  |  |  | 100g Weiche Vaseline oder Eucerin |
 | |
Vaseline in einem Wasserbad bei etwa 40 �C erwärmen, bis sie flüssig ist. Anschließend die Calendula-Blüten hinzugeben, behutsam unterrühren und das Ganze noch etwa zehn Minuten im Wasserbad belassen. Danach muss dieser Salbenansatz zwei bis drei Tage zugedeckt ziehen, bis sich die Vaseline leicht orange verfärbt hat. Nun die Mischung erneut im Wasserbad bei ca. 40�C erwärmen und noch einmal so lange vorsichtig durchrühren, bis das Gemisch flüssig ist und die Blüten absinken. Jetzt kommt das Abfiltern, für das sich am besten ein grobmaschiges Baumwolltuch oder ein ungebrauchtes Baumwoll-Teesieb eignet. Langsam in ein Vorratsgefäß laufen lassen, das Baumwollsieb kräftig ausdrücken - fertig ist eine hervorragende Calendula-Hautpflege-Salbe.
|
 | | Ringelblumenöl selbst gemacht |  | |
Noch einfacher als die Herstellung einer Salbe ist die eines Ringelblumen-Öls. Es kann direkt auf kleinere Wunden, leichte Verbrennungen oder auch Sonnenbrand aufgetragen werden.
|
 | | Rezept |  |  |  | etwa eine Handvoll Ringelblumenblüten
|  |  |  | Kaltgepresstes Olivenöl
|  |  |  | Marmeladenglas mit Schraubverschluss |
   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Auf der Fensterbank
müssen die Calendula-
Blüten drei Wochen lang
auf das Öl einwirken. |  |
Ringelblumenblüten können Sie im eigenen Garten ernten oder getrocknet in der Apotheke bzw. Drogerie kaufen. Die geben Sie in ein Marmeladenglas mit Schraubverschluss. Darüber einfach soviel Öl gießen bis die Blüten gerade bedeckt sind. Hierfür eignet sich am besten ein kaltgepresstes Olivenöl. Das Glas verschließen und an einen warmen, sonnigen Platz stellen, z.B.auf die Fensterbank. Von Zeit zu Zeit das Glas gut schütteln, damit sich die Blüten verteilen. Nach etwa drei Wochen kann man Öl und Blüten mit einem Kaffeefilter oder ungebrauchten Baumwollteesieb trennen. Das Ringelblumenöl lässt sich nun sofort pur verwenden. Zur Aufbewahrung am besten in ein dunkles Fläschchen geben und mit dem Abfülldatum beschriften. Je nach Qualität des Öls und der Lagerung hält es sich ungefähr ein halbes Jahr.
Dieses Öl können Sie nun auch in Cremes einarbeiten, z.B. in die Calendula-Hautcreme � la hobbythek.
 | | Calendula-Hautcreme � la hobbythek |  |  |  | 2-3 TL Ringelblumenöl (Herstellung siehe oben)
|  |  |  | 50g Cremaba hat |
 | |
Für die Calendula-Hautcreme nach und nach das Ringelblumenöl zur Cremaba dazugeben und gut verrühren. Durch das Öl bekommt die Creme eine leicht gelbliche Färbung. Die Calendula-Hautcreme am besten im Kühlschrank aufbewahren. |
| | |