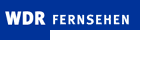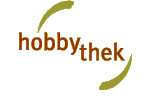|
| | hobbytipp 330  Lust auf Spielen neu entdeckt   Die Frage des Spielzeugs   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Was ist gutes, was
schlechtes Spielzeug? |  |
Noch nie hatten unsere Kinder so viele Spielsachen wie heute. Ein normales Spielwarengeschäft führt im Durchschnitt an die 20.000 Artikel. Beim Blick in die meisten Kinderzimmer gewinnt man gar den Eindruck, dass es mehr um das Sammeln und Zurschaustellen der Spielsachen geht als um echtes Spielen.
Bei der Auswahl scheiden sich allerdings die Geister: Manche Eltern halten Holzspielzeug & Co für richtig, andere schenken lieber, was "in" ist: eine Playstation, Babypuppen aus Kunststoff oder die aktuellen Actionfiguren aus dem neuesten Kinofilm. Wiederum andere Eltern sind eher zurückhaltend. Nach dem Motto "weniger ist mehr", versuchen sie möglichst wenige Spielsachen zu haben.
   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Im Dschungel des Spiel-
warenangebots kann der
Spiel-gut-Punkt helfen
|  |
Bei der Bewertung, was nun gutes und was schlechtes Spielzeug ist, geht es vor allem um die so genannte "Offenheit", um den "offenen Charakter" der Spielsachen. Demnach erlauben gute Spielsachen, dass Kinder mit Hilfe des Spielzeugs ihre eigene Phantasie entfalten und dass sie selber aktiv werden können. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang auch von der Multifunktionalität von Spielzeug, das möglichst viel Freiraum für die eigene Kreativität lässt. Solche offenen Spielsachen sind z. B. Holzklötze: Kinder können damit bauen, konstruieren, einen Raum gestalten, Auto spielen und vieles andere mehr. Das Problem vieler moderner Spielsachen liegt hingegen darin, dass sie die freie Gestaltung sehr einschränken und nur eine Spielweise zulassen. Man kann beispielsweise auf einen Knopf drücken und dann taucht eine bestimmte Figur auf. Experten bezeichnen diese als monofunktionelle Spielsachen.
Diese Kriterien spielen auch eine Rolle bei der Vergabe des "Spiel-gut-Punktes". Er bietet eine gute Möglichkeit, die Qualität von Spielsachen einzuschätzen. Verliehen wird er vom "Arbeitsausschuss Kinderspiel und Spielzeug e.V", der aus Fachleuten unterschiedlichster Richtungen besteht und bereits im Jahr 1954 gegründete worden ist. Pädagogen, Psychologen, Kinderärzte bis hin zu Architekten und natürlich auch Eltern bewerten die Spielsachen.
Kriterien sind neben der "Offenheit" zum Beispiel auch der Spielwert, die Haltbarkeit, die Qualität der Anleitung oder die Alterseignung. Aber auch die gesundheitliche Einschätzung und die Umweltverträglichkeit bzw. die Sicherheit der Spielsachen wird geprüft. Aber erst, wenn sie durch Kinder und Jugendliche auch im Ernstfall, also beim Spiel erprobt wurden, fällt die Entscheidung des Vereins, den "Spiel-gut-Punkt" zu verleihen.
Bei der Gesellschaft "Spiel-Gut" (s. Bezugsquellen) ist "Das Spielzeugbuch" erhältlich. Es kostet etwa 8 Euro und enthält ein Verzeichnis mit allen Spielsachen, die mit dem "Spiel-gut-Punkt" ausgezeichnet sind.
  Das Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten"  Was passiert, wenn auf einmal gar kein Spielzeug mehr da ist? Das ist im Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten" erprobt worden. Zum ersten Mal trugen 1992 Kinder des Kindergartens im oberbayerischen Penzberg eigenhändig und freiwillig ihre Spielsachen in den Keller - und dort blieben sie drei Monate lang. Zurück blieben nur Kissen, Decken, Stühle und Tische. Seitdem hat das Projekt Schule gemacht und wurde in Deutschland, aber auch im Ausland vielfach erfolgreich durchgeführt und wissenschaftlich untersucht.
Das Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten" basiert auf der Erkenntnis, dass ausgebildete Lebenskompetenzen wie z. B. Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Selbstvertrauen oder auch Frustrationstoleranz wichtige Schutzfaktoren gegen eine mögliche Suchtgefährdung sind. So kann das Projekt Kindern einen Zeit-Raum und einen Spiel-Raum schaffen, ihre Möglichkeiten und Grenzen zu erproben. Da in der spielzeugfreien Zeit die Aktivitäten konsequent von den Kindern ausgehen und sich die Erzieherinnen und Erzieher ganz bewusst zurücknehmen, können die Kinder bestimmte "Lebenskompetenzen" erproben, als sinnvoll erleben und weiterentwickeln. Dazu gehört dann auch, dass nicht immer alles klappt, dass man Fehler macht und dass man auch mal Frustrationen aushalten muss, ohne dass diese gleich von Erwachsenen ausgeglichen werden.
In der Suchtforschung gibt es viele Hinweise darauf, dass Menschen, die vielfältige Lebenskompetenzen entwickelt haben, die mit ihren Schwächen umgehen und Handlungsalternativen selbst entwickeln können, deutlich weniger suchtgefährdet sind als Menschen, die dies nicht können. Lebenskompetenzen sind somit Schutzfaktoren gegen Sucht, denn Sucht ist immer auch eine Art der Kapitulation vor den Anforderungen, die das Leben an uns stellt.
| | |