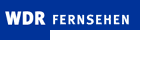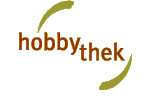|
| | hobbytipp 337  Dynamisch gegen Rückenschmerzen   Auf die Haltung kommt es an   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Innen wie Gelee, drum-
herum fest und doch
flexibel - unsere Band-
scheiben sind perfekt an
ihre Aufgabe angepasst. |  |
Wie wichtig Dynamik für einen gesunden Rücken ist, zeigt ein weit verbreitetes Rückenleiden: Der Bandscheibenvorfall. Er wird durch einseitige, starre Haltungen nämlich extrem begünstigt. Das liegt zum einen an der Art ihrer Nahrungszufuhr, wie wir sie bereits im hobbytip 336 erläutert haben.
Zum anderen liegt es aber an ihrem Aufbau und ihrer Funktionsweise. Die Bandscheiben liegen ja bekanntlich jeweils genau zwischen zwei Wirbelkörpern. Sie bestehen aus zwei verschiedenen Komponenten. Im Inneren befindet sich der so genannte Gallertkern: Der besteht aus einer zähflüssigen Masse und wirkt deshalb wie ein Stoßdämpfer. Umgeben ist der Kern von einem festen und doch flexiblem Faserring. Vergleichen lässt sich das vielleicht mit einem von einem Autoreifen ummantelten Miniwasserbett mit Gelee-Füllung.
   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Der Gallertkern gleicht
Höhenunterschiede aus
indem er sich in die
jeweilige Gegenrichtung
zur Beugung des
Rückens bewegt. |  |
Wenn wir uns nach vorne beugen, zum Beispiel bei der Schreibtischarbeit, verlagert sich der Kern in die Gegenrichtung, also nach hinten und gleicht so den entstandenen Höhenunterschied aus. Der Faserring ist dafür da, diese Verlagerung abzumildern und zu verlangsamen. Und nachdem wir uns wieder gerade aufrichten, drückt er den Kern langsam, aber sicher immer wieder in die Mittelposition zurück.
   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Leider nicht mehr
rückgängig zu machen,
ein Teil des Gallertkerns
hat sich durch den
Faserring gedrückt |  |
Je länger wir jedoch in der starren, gebeugten Position verharren, desto weiter verlagert sich der Gallertkern nach außen und desto länger braucht wiederum der Faserring, um ihn zurück in die Mitte zu drücken. Da das System sehr träge reagiert, reichen kurze Pausen nicht aus, um es wieder in seinen Ausgangszustand zu bringen. Der Druck auf die Hinterkante des Faserrings bleibt so latent bestehen, bis dieser dann eines Tages reißt und sich der Gallertkern herausdrückt. Es kommt zu einem Bandscheibenvorfall.
Doch ein Bandscheibenvorfall bedeutet nicht unbedingt eine Katastrophe. Studien konnten zeigen, dass zwischen 20 und 36 % aller Gesunden mit einem Bandscheibenvorfall herumlaufen, ohne auch nur das geringste davon zu spüren. Vorbeugend lässt sich allerdings eine Menge machen: Bringen wir einfach Dynamik ins unseren (Arbeits-)Alltag.
 | | Wie die Profis weiterhelfen - Therapiemethoden |  | |
Selbstverständlich gibt es viele Beschwerden, die eine gezielte Therapie durch Ärzte, Physio-, Entspannungs- und Manualtherapeuten, Akupunkteure, Psychologen und andere Spezialisten erfordern.
Bei der Physiotherapie werden die Anforderungen stufenweise verändert. Zuerst gilt es ein Gefühl, ein Bewusstsein, für den Ort des Geschehens zu bekommen: Um welche Körperteile geht es? Wie ist der Status quo? Wann verändert sich was, bei welcher Bewegung? Dann erfolgen in der Regel isometrische Übungen, also solche mit Druck und Gegendruck, bei der die Ausgangslage unverändert bleibt. Es folgen dann durch den Therapeuten geführte Bewegungen, dann kontrollierte Übungen aus bestimmten Positionen heraus und zum Schluss dynamisch-funktionelle Übungen, welche Alltagsabläufen nahekommen. Dies kann durch Gerätetraining erweitert werden.
Auch Manuelle Therapie und Osteopathie wirken oft wahre Wunder, sowohl die kurzfristige Linderung, als auch den langfristigen Erfolg betreffend. Ihre Ausführung bedarf einer fundierten, klinischen Erfahrung und gründlichen Voruntersuchung. V.a. die Osteopathie ist hier sehr genau und bezieht auch andere Organsysteme in Diagnose und Therapie mit ein.
Injektionen und Schmerzmedikamente sind zur akuten Schmerzbekämpfung und -linderung geeignet. Der Schmerzkreislauf wird auf diese Weise gebrochen.
Die Injektionen bringen lokal wirkende Mittel (v.a. Lokalanästhetika oder Kortison) unmittelbar an den Ort des Geschehens, also z.B. direkt an eine durch einen Bandscheinbenvorfall bedrängte Nervenwurzel oder an die kleinen Wirbelgelenke. Genau wie die Medikamente in Tablettenform dienen sie der Schmerzbekämpfung und Entzündungshemmung.
Die Akupunktur wird inzwischen v.a. als Verfahren der Schmerzbekämpfung sehr häufig und erfolgreich eingesetzt. Sie basiert auf den Grundsätzen der Chinesischen Medizin, einem ganz eigenen System von Erklärung und Heilung von Krankheiten. Die Wirkweise der Akupunktur nach unserem wissenschaftlichen Kriterien ist noch nicht abschließend geklärt. Es gibt jedoch schon einzelne Studien, die unvermutete Zusammenhänge aufzeigen. Diskutiert werden u.a., Wirkungsmechanismen über die Ausschüttung körpereigener Opiate (Endorphine) und das autonome Nervensystem.
Zur Entspannung und einer besseren Körperwahrnehmung gibt es inzwischen ein breites Angebot: Ob Tanztherapie, Feldenkrais, Alexander-Technik oder Autogenes Training. Jeder kann das Richtige für sich finden.. Leider bezahlen Krankenkasse diese Kurse in der Regel nicht. Es gibt viele Angebote dazu z.B. an Volkshochschulen. |
  Die sanfte Operation   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Ohne grössere Verletz-
ungen gelangt der Arzt
mit der feinen Nadel bis
in den Bandscheibenkern |  |
Allein in Deutschland müssen jedes Jahr 60 bis 100.000 Patienten wegen einem Bandscheibenvorfall operiert werden. Die "klassische" offene Bandscheibenoperation wird dabei immer noch mit Erfolg angewandt. Ein gefürchtetes Op-Risiko ist dabei allerdings das so genannte Postdiskotomiesyndrom (PDS) bei dem das Narbengewebe unkontrolliert wuchert und seinerseits auf die Nerven drückt.
Das kann fast noch größere Probleme bereitet, als der ursprüngliche Bandscheibenvorfall. Daher ist man sehr zurückhaltend geworden, die OP-Indikation zu stellen und gibt den konservativen Verfahren den Vorrang.
Für diejenigen aber, die einerseits eher wechselhafte Beschwerden haben, welche aber trotz konservativer Verfahren nicht so recht verschwinden wollen und deren Bandscheibenvorfall andererseits zu klein ist um dafür die Risiken einer Operation auf sich zu nehmen, gibt es neue Lösungen: Moderne computertomographie-gesteuerte, mikroinvasive OP-Techniken. Perkutane Nukleotomie heisst das Verfahren, welches z.B. Prof. Dr. med. Dietrich Grönemeyer - der Bruder des bekannten Sängers - an seinem Institut in Bochum durchführt. Diese Operationstechnik hat sich in den letzten Jahren immer häufiger in Deutschland durchgesetzt. Der Arzt kann sogar auf eine Vollnarkose verzichten und der Patient wird nur örtlich betäubt. Für die ambulante Operation genügt schon eine Millimeter kleine Kanüle. Mit dieser gelangt der Arzt bis in den Gallertkern der Bandscheibe, der Patient verspürt allenfalls ein leichtes Ziehen. Knifflig ist allerdings die richtige Positionierung der kleinen Nadel. Neben viel Fingerspitzengefühl hilft ein Röntgengerät dem Arzt, mit diesem kontrolliert er immer wieder die genaue Stellung.
   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Der weiche Gallertkern
wird regelrecht ver-
dampft und schrumpft
somit |  |
Durch hochfrequenten Strom, der an der Spitze der Kanüle, durch eine Sonde appliziert wird, sollen die elektrischen Teilchen, die Ionen, im Gewebe in schnelle Bewegung versetzt werden. Durch diese Dynamik stoßen die Ionen aneinander, dadurch wird Wärme erzeugt, die zum Platzen der Zellen des Gallertkerns führt. Er wird kleiner, der Druck auf die Nervenwurzel damit verringert.
 | | Aus dem Stand ins Gleichgewicht |  | Ein natürlicher Wechsel von Stehen, Sitzen und Bewegen ist das Beste für einen gesunden Rücken. Wer zuviel sitzt, gerät schnell in einen ebenso trägen Geisteszustand.
Im Stand eine gute Haltung einzunehmen, verteilt das Gewicht optimal auf die einzelnen Gelenke der Wirbelsäule. So werden auch die Gelenkflächen gleichmäßig belastet. In dieser Balance bildet die Wirbelsäule weder einen Buckel, noch ein Hohlkreuz, sondern bleibt in ihrem naturgegebenen Verlauf. Die Muskulatur zeigt dann einen nur minimalen Spannungszustand.
Eine gesunde Haltung fördert ganz nebenbei die Lungen- und Verdauungsfunktion. Mit Hilfe eines Spiegels erkennt jeder leicht, woran es möglicherweise hapert. Hierauf sollte besonderes Augenmerk gelegt werden:
|  |  |  | der Kopf ist gerade, der Hals gestreckt
|  |  |  | die Schultern sind auf gleicher Höhe und gesenkt
|  |  |  | gerader Rücken in natürlicher S-Form
|  |  |  | die Hüften bilden eine horizontale Linie
|  |  |  | Bauch und Gesäß sind eingezogen
|  |  |  | die Knie sind nicht durchgestreckt, sondern leicht gebeugt |
   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Mit dem Lotlinientest
kann man seine Haltung
checken
|  |
Ein guter Test zur Überprüfung der Haltung, lässt sich mit einem Lot durchführen. Dazu wird ein Streifen Isolierband exakt vertikal auf einen Spiegel geklebt. Das Lot verläuft dann vom Ohr entlang, zum Schultergelenk, Lendenwirbelsäule, Hüftgelenk bis hin zu den Fußknöcheln.
 | | Training fürs Stehvermögen |  | |
Aufrecht korrekt zu stehen gelingt in feiner Abstimmung zwischen einer Stabilität und dem Ausbalancieren des Körperschwerpunktes oberhalb der Füße. Dass es sich dabei um einen aktiven Vorgang handelt, merkt, wer sich einmal mit geschlossenen Augen auf ein Bein stellt. Die dabei spürbaren, minimalen Korrekturbewegungen sind charakteristisch für die aufrechte Körperhaltung. Einen ähnlichen Effekt erzielt, wer sich mit beiden Füßen je auf eine (mechanische) Fußwaage stellt. Das "Zittern" der Anzeigen ist ein Hinweis auf das labile Gleichgewicht. Es muss permanent neu gefunden werden und ist niemals statisch.
Eine unverkrampfte Haltung ist das Beste für den Rücken. Unsere Universalwippe, mit nur einem Ball, fördert die dazu notwendige, unbewusste Feinkoordination. Nebenbei hat sie auch noch einen nützlichen Trainingseffekt für die Stabilisationsfähigkeit der Rückenmuskulatur:
Zur Durchführung der Übung stellen Sie sich zunächst mit beiden Füßen auf das Brett, um zu spüren, wie es wackelt. Dazu treten Sie erst mit dem einen Fuß ziemlich mittig auf das Brett, so dass Sie danach den anderen daneben stellen können. Von dieser Stellung aus die Füße nach und nach und abwechselnd immer mehr auseinander stellen, was die Stabilität erhöht. Drücken Sie die Knie nie ganz durch und stehen Sie nicht im Hohlkreuz, ggf. das Becken etwas aufrichten. Spüren Sie nun vor allem, wie Ihr unterer Rücken die entstehenden Positionsveränderung ausgleicht. Sie sollten dahin kommen, dass das wackelige Gefühl immer mehr abnimmt. Lassen Sie sich Zeit, um Sicherheit zu gewinnen und die Gefahr eines Sturzes zu verhindern. Dann läuten Sie die nächste Stufe ein, indem Sie ein wenig in die Knie gehen und wieder hoch kommen oder die Arme vor und zurück bewegen. Später kann beides zusammen versucht werden. Der nächste Schwierigkeitsgrad besteht im Schließen der Augen - bitte mit Vorsicht, dies ist sehr viel schwieriger! Dann nehmen Sie wieder Bewegungen wie oben hinzu. Der nächste Sprung besteht im Einbeinstand auf der Mitte des Bretts, zuerst mit offenen Augen! Versuchen Sie's mit beiden Seiten. Wenn Sie das raus haben, können Sie beginnen das jeweils freie Bein in kleinen, langsamen Bewegungen vor und zurück, bzw. hinten und vorne seitlich hin und her zu bewegen.
|
  Die Universal-Wippe der hobbythek   |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Die hobbythek-Universal
Wippe verbessert die
Feinkoordination und
stabilisiert die Rücken-
muskulatur
|  |
Diese Wippe besteht aus einer kreisrunden Multiplexscheibe mit 40 Zentimeter Durchmesser und 15 Millimeter Stärke. Als "Drehachse" verwenden wir einfache Tennisbälle, die den Vorteil haben, leicht zu federn, den Fußboden nicht zu beschädigen und der Wippe einen rutschsicheren Stand zu verleihen.
Damit die Bälle sicher in der Scheibe gelagert sind, müssen noch drei Löcher, im Durchmesser von etwa fünf Zentimeter, ausgesägt werden, am besten mit einem Lochsägeaufsatz für die Bohrmaschine. Zeichnen Sie hierzu auf der Scheibe eine Linie, die durch den Mittelpunkt führt. Die Mittelpunkte der Löcher befinden sich nun sowohl im Scheibenmittelpunkt, als auch jeweils im Abstand von sechs Zentimetern vom Scheibenrand.
Befinden sich die Bälle außen, haben Sie eine konventionelle Wippe. Mit einem Ball in der Mitte kann sogar in alle Richtungen balanciert werden.
 | | Im Alltag gut stehen |  | |
Schon wenige Tipps und Tricks können helfen, sich im Alltag einen rückenschonenden Stand zu verschaffen. Daher sollten vor allen Dingen Hausgeräte und Einrichtungsgegenstände so ausgewählt und genutzt werden, dass der Oberkörper stets in aufrechter Position stehen kann.
Obwohl die Nutzung von Stehpulten viel rückenfreundlicher ist, als das ewige Sitzen, sind sie leider in Vergessenheit geraten. Telefonate und Schreibarbeiten können an diesem Möbel wunderbar erledigt werden. Ein gesunder Sitz-Steh-Wechsel wird möglich. Aktuelle Forschungsarbeiten an der Orthopädischen Uniklinik Bochum konnten gar eine Verbesserung der aufrechten Körperhaltung belegen.
Höhenverstellbare Stehhilfen wirken einer Ermüdung der Rückenmuskulatur entgegen und verbessern die Durchblutung der Beine. Beim Bügeln und an der Werkbank leisten sie ausgezeichnete Dienste.
|
 | | Stehpult - maßgeschneidert ! |  | Für ein freistehendes Stehpult benötigt man:
|  |  |  | Holzplatte 50 cm x 50 cm x 2 cm |  |  |  | Kantholz im Querschnitt 35 mm x 35 mm
|  |  |  | Holzschrauben 5 X 60 mm |  |  |  | Holzleim |
 | Die Länge der beiden Vorderbeine entspricht dem Abstand vom Fußboden zum Ellenbogen, die Hinterbeine sind etwa 15 Zentimeter länger. Achten Sie beim Absägen darauf, dass jeweils ein Kantholzende im 20-Grad-Winkel abgeschrägt ist.
Nachdem die Beine an die Eckbereiche der Platte, mittels Leim und Schrauben, befestigt wurden, müssen möglicherweise die Beinlängen am unteren Ende korrigiert werden.
Die seitlichen Beinpaare erhalten Querverstrebungen auf mittlerer Höhe. Die Verstrebungen an der Vorder- und Rückseite verlaufen mit 15 Zentimetern Bodenabstand, aus Stabilitätsgründen, versetzt und übernehmen zusätzlich die Funktion einer Fußreling.
Versehen Sie zum Schluss die Unterkante der Pultplatte mit einem Kantholz, das die aufgelegten Gegenstände am Heruntergleiten hindert.
Da ein freistehendes Stehpult relativ viel Raum benötigt, stellt ein platzsparendes Wandpult eine gute Alternative dar. Dieses hat außerdem den Vorteil, dass es sich durch seine Höhenverstellbarkeit individuell an jede Körpergröße anpassen und sogar als gewöhnlicher Tisch nutzen lässt.
Benötigtes Material:
|  |  |  | Pultplatte mit "Rutschbremse", wie oben beschrieben
|  |  |  | Holzbrett 47 cm x 15 cm x 2 cm
|  |  |  | 2 Einloch-Wandschienen der Länge 50cm aus dem Regalbereich
|  |  |  | 2 dazugehörige Tragarme der Länge 48cm
|  |  |  | Holzschrauben 5 x 60 mm |  |  |  | Holzleim |  |  |  | Dübel S8 |
  Zur Erzielung der 20-Grad-Plattenneigung wird die Pultplatte auf zwei dreieckige Seitenteile geschraubt, die man erhält, wenn man das kleine Brett diagonal durchsägt. Die Tragarme werden an den Unterseiten der Seitenteile befestigt. Achten Sie beim Kauf der Tragarme darauf, dass sich diese nur in der Senkrechten einhängen lassen. Müssen diese nämlich gekippt eingesetzt werden, kann das aufgeschraubte Pult die Befestigung blockieren.
Die Wandschienen werden senkrecht parallel nebeneinander an die Wand gedübelt, wobei das untere Ende etwa 70 Zentimeter Bodenabstand haben sollte.
 | | Die Stehhilfe für Bastler |  | Für den Nachbau benötigen Sie:
|  |  |  | einen ausrangierten fahrbaren Bürostuhl mit einem Fußkreuz aus Metall (z.B. Trödelmarkt)
|  |  |  | Metallrohr mit einem Innendurchmesser von ca. 30 Millimeter
|  |  |  | Fahrradsattel, vorzugsweise mit Gel- oder Luftfüllung
|  |  |  | Sattelstütze der Länge 35 Zentimeter samt Sattelklobe
|  |  |  | Flügelschraube M8 x 40 mm |
  Zunächst muss das Fußkreuz vom Stuhl getrennt werden.Dazu werden in der Regel seitlich oder an der Unterseite Schrauben gelöst. Eine Schlosserei, die auch auf den sorgfältigen Umgang mit gasgefederten Stühlen eingestellt ist, kann helfen.
In die Mitte des Fußkreuzes wird nun das Metallrohr gesteckt und an mehreren Punkten verschweißt. Das obere Rohrende muss einen Fußbodenabstand von etwa 55 Zentimetern besitzen.
Etwa fünf Zentimeter vom oberen Rohrende wird ein M8-Gewindeloch geschnitten, in das die Flügelschraube gedreht wird.
Die Sattelstütze wird mit mehreren Arretierungslöchern, im Durchmesser von neun Millimetern versehen, ins Rohr gesteckt und mit der Flügelschraube in der gewünschten Höhe gehalten.
Der Sattel wird üblicherweise mittels Klobe befestigt.
| | |